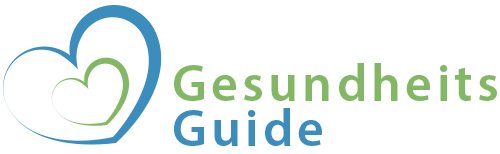Logopädie: Mehr als nur Sprecherziehung
Wie selbstverständlich ist es doch, dass der Mensch sprechen kann. So nutzt er seine Sprache als erstes Medium für seine alltägliche Kommunikation. Doch damit ist nicht genug. Seine Artikulation wird maßgeblich beeinflusst von seiner Wahrnehmung, dem Denken als auch dem Gehirn. Letzteres beteiligt sich dabei beispielsweise beim Lösen von Problemen mit. Verschiedene Organe und weit mehr als 100 Muskeln sind beim Sprechen beteiligt. Im Rahmen einer normal ablaufenden Konservation nutzen Menschen durchschnittlich 120 Wörter pro Minute. Die reguläre Sprachentwicklung ist circa zwischen dem vierten und fünften Lebensjahr abgeschlossen. Sobald jedoch Kinder nicht richtig sprechen lernen beziehungsweise Erwachsene die Sprache aufgrund einer Erkrankung nicht mehr komplett nutzen können, kann eine logopädische Therapie bei der Entwicklung beziehungsweise Regeneration des Sprechens unterstützen.
Was bedeutet Logopädie?
Das Wort Logopädie stammt aus dem Griechischen. Das Wort „logos“ bedeutet Wort und „paideuein“ meint erziehen. Im Jahr 1913 wurde der Begriff erstmalig genutzt. 1924 führte der Wiener Mediziner Emil Fröschels Logopädie in der medizinischen Sprachheilkunde ein.
Die Fachdisziplin Logopädie lässt sin verschiedene Teilbereiche unterteilen, welches die Beeinträchtigung folgender Elemente zum Gegenstand hat:
- Sprache
- Sprechen
- Stimme
- Schlucken
- Hören
Grundsätzlich bezieht sich das Arbeitsfeld der Logopädie auf:
- Vorbeugen
- Beratung
- Diagnostik
- Therapie
- Rehabilitation
- Lehre
- Forschung
Dazu gehören Gebiete wie beispielsweise:
- Stimme allgemein
- Stimmtherapie
- Stimmstörungen
- Sprechen
- Sprechstörungen
- Sprechtherapie
- Sprache
- Sprachstörungen
- Sprachtherapie
- Schlucken
- Schluckstörungen
- Schlucktherapie
Was hat die Atmung mit dem Sprechen lernen zu tun?
Bei Menschen befindet sich der Kehlkopf (Larynx) etwas niedriger als bei anderen Säugern. Er gilt als wesentliches Organ beim Sprechen und besteht aus Sehen, Muskeln und Knorpeln. Bis zum zweiten Lebensjahr liegt der Kehlkopf bei Kleinkindern noch etwas höher. Aufgrund dessen ist es kleinen Kindern möglich zu schlucken, während sie atmen. Babys können somit einfach gestillt werden. Durch das spätere Absinken des Larynx ist das Erlernen der aktiven Sprache möglich. Zudem erlernen die Kinder während dieser Phase körperlicher Veränderungen eine neue Atemtechnik hinzu.

Nachdem die Zwerchfellatmung gute Dienste leistete, wird nun die Brustatmung benötigt. Schlussendlich entwickelt sich aus Letzterer dann die notwendige Sprechatmung, welche dadurch geprägt ist, dass der Sprechende ein gigantisches Volumen an Luft, welche schnell ein- und ausgeatmet wird, benötigt. Der schlussendliche Sprechvorgang ist ein komplexer Prozess, der maßgeblich von der Stimmgebung, der Atmung als auch der korrekten Aussprache geprägt ist. Das Gehirn übernimmt bei all diesen Abläufen die koordinierende Aufgabe.
Wie wird der Sprechlaut erzeugt?
Für die Lauterzeugung muss im ersten Schritt eingeatmet werden. Es wird Luft aus den Lungen durch die sogenannte Luftröhre bis hin zum Larynx gedrückt. Im Kehlkopf befinden sich Stimmlippen, die aus einem Paar von schmalen Muskelbändern bestehen. Sobald eine leichte muskuläre Spannung dieser in Kombination mit einem Luftstrom zustande kommt, beginnen diese zu vibrieren. Dieser Prozess heißt Phonation (Stimmgebung). Der entstehende Ton wird durch beteiligte Resonanzräume gebildet. Die verantwortlichen Räume liegen oberhalb des Larynx im Mund-, Rachen- und Nasenraum. Logopäden sprechen bei diesem Vorgang von Artikulation.
Wo sind Logopäden in Österreich tätig?
Fachkräfte aus dem Bereich Logopädie sind in Österreich in verschiedenen Institutionen tätig. Hierzu zählen öffentliche Einrichtungen wie:
- Ämter
- Behinderteneinrichtungen
- Krankenhäuser
- Kindergärten
- Schulen
- Pflegeheime
- Sozialversicherungsanstalten
Darüber hinaus arbeiten Logopäden und Logopädinnen auch als Freiberufler in eigenen Praxen. Grundsätzlich arbeiten alle Fachkräfte aus dem Bereich Logopädie in Österreich eigenverantwortlich als auch patientenspezifisch. Dies bedeutet, sie können grundsätzlich ihren Therapieansatz als auch die Therapiemethode frei wählen.
Wann ist eine logopädische Therapie indiziert?
Logopäden können beim Auftreten von spezifischen Störungsbildern und Krankheiten therapieren. Zu typischen Anwendungsfeldern zählen beispielsweise:
- Sprachentwicklungsstörungen beziehungsweise –verzögerungen bei Kindern: Hierzu zählt die spezifische Sprachentwicklungsstörung
- Sprech- und Sprachstörungen bei Demenz wie Alzheimer
- Mutismus, selektiver Mutismus
- Autismus
- Redeflussstörungen: Poltern, Stottern
- Störungen phonologischer Art: gestörte Anwendung von Lauten wie beispielsweise Auslassungen, Vertauschungen oder Hinzufügungen
- Myofunktionelle Störungen (orofacial)
- Verminderter Wortschatz (passiv als auch aktiv)
- Stimmstörungen (Dysfonien)
- Schlucktherapie (Dysphagie): postoperative Schluckstörungen (nach dem Entfernen einzelner Teile von Zunge oder Rachen aufgrund von Tumoren), neurologische Schluckstörungen (beispielsweise bei infantiler Zerebralparese oder nach einem Schlaganfall
- Phonetische Dyslalien: Lispeln, Artikulations- und Sprechfehler
- Dysgrammatismus: Die grammatikalische Fähigkeit ist stark eingeschränkt.
- Dysarthrie: Koordinationsstörung von Artikulation, Stimme, Atmung als auch Tonus (Steht im Zusammenhang mit Morbus Parkinson, infantiler Zerebralphrase, Amyothrophische Lateral-Sklerose (ALS), Schlaganfall, Multiple Sklerose oder Schädel-Hirn-Traumata
- Aphasien nach Unfällen mit oder ohne Schädel-Hirn-Traumata der nach Schlaganfall
Darüber hinaus eignet sich ein logopädischer Therapieplan bei:
- Störungen des Hörens als auch der auditiven Wahrnehmung
- Sprechtonänderungen während einer geschlechtsangleichende Therapie
Wie läuft die logopädische Behandlung ab?
Auf Grundlage der Überweisung erfolgt eine spezielle Überprüfung seitens des Logopäden. Diese Tests beinhalten folgende Teilbereiche:
- Wortschatz
- Artikulation
- Sprachverständnis
- Schreib-, Lese- und Rechenleistung
- Atemfunktion
- Stimmfunktion
- Schluckfunktion
Einzelne Teilergebnisse werden danach mit den Resultaten der ärztlichen Diagnose vereint, um eine adäquate Behandlungsmethode auszuwählen. Danach legen Logopäden in direkter Kooperation mit dem Patienten beziehungsweise seiner Bezugspersonen die einzelnen Therapieziele fest.
Die Behandlung setzt sich danach aus verschiedenen Teilbereichen zusammen
- spezielle Übungen
- Gespräche über den bisherigen als auch aktuellen Behandlungsverlauf
- Konkrete Anleitungen zum eigenständigen Üben zu Hause als auch in Schule und Beruf
——-
Quelle:
¹ Wie Kinder Sprache lernen (gesund.co.at)
Linktipps
– Migräne bei Kindern erkennen und abklären
– Magersucht frühzeitig erkennen
– Legasthenie: Wenn aus Buchstaben Salat wird
– Thema Kopfschmerzen